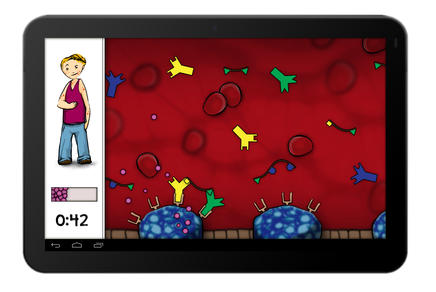Newsletter
Buchstabensalat durch Allergenverordnung
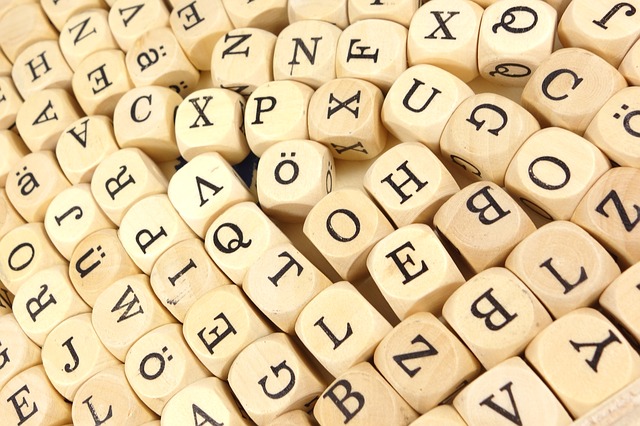
Bild: Bild: Pixabay, CC0
An diesem Wochenende ist es soweit: Mit 13-12-2014 muss in Österreich die von der EU verordnete Kennzeichnungspflicht von Allergenen umgesetzt werden - eine Neuerung, die Allergikern und Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten helfen soll. Diese wird vielerorts mit großer Skepsis betrachtet.
Bestehende Verordnung ausgeweitet
Bisher gab es die Verpflichtung, Allergene in verpackten Lebensmitteln zu kennzeichnen. Mit Inkrafttreten der neuen Allergenkennzeichnungspflicht müssen ab Jahresende die Allergene bei verpackten Waren in der Zutatenliste hervorgehoben werden . Als weitere Neuerung wird die Kennzeichnungspflicht auf lose Waren ausgedehnt. Somit müssen die wichtigsten Allergene nun beispielsweise in Restaurants, Imbissen, Buffets, Cateringbetrieben, Krankenhäusern oder Bäckereien ausgewiesen werden. Auch Christkindlmärkte sind davon betroffen.
Die Informationspflicht betrifft die folgenden 14 von der EU festgelegten Hauptallergene: Glutenhaltiges Getreide, Krebstiere, Eier, Fische,Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen,Schwefeldioxid und Sulphite, Lupinen und Weichtiere. Auch die aus den jeweiligen Allergenen gewonnen Erzeugnisse sind von der Kennzeichnungspflicht betroffen.
Nationale Regelung für Kennzeichnung
In welcher Form die Allergenkennzeichnung erfolgen soll, wird national geregelt. In Österreich kann die Weitergabe der Information an die Endverbraucher schriftlich oder mündlich erfolgen. Im Fall der mündlichen Variante ist ein Hinweis an einer gut sichtbaren Stelle ausreichend, dass Informationen auf Nachfrage mündlich erhältlich sind. Hierfür zuständig ist dann eigens geschultes Personal. Eine klare Empfehlung kommt von der AGES allerdings für die schriftliche Informationsweitergabe. „Schriftlich ist man rechtlich einfach besser abgesichert“, so Markus Zsivkovits im Rahmen einer AGES Allergeninformations-Schulung. Bei der schriftlichen Information können Abkürzungen oder Symbole verwendet werden, wenn diese in unmittelbarer Nähe aufgeschlüsselt werden. Die Kennzeichnung kann in der Speise- oder Getränkekarte, auf einem Schild oder Aushang oder in geeigneter elektronischer Form erfolgen. Hinsichtlich der Aufschlüsselung der schriftlichen Information gibt es zwar die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums, einen bestimmten Buchstabencode von A-R für die entsprechenden Allergene zu verwenden, einheitliche Vorgaben dafür gibt es aber keine.
In jedem Fall muss die Information des Endverbrauchers unaufgefordert erfolgen und jederzeit verfügbar sein.
Kennzeichnungspflicht erhitzt Gemüter
Die neue Regelung, die zusätzlich zur Allergeninformation der Konsumenten auch eine schriftliche Dokumentationspflicht für die Lebensmittelanbieter mit sich bringt, führt zu großer Verunsicherung. Gastronomen bezweifeln die Umsetzbarkeit, beispielsweise wechselnde Tageskarten zu dokumentieren und bemängeln schon jetzt die Papierflut, die dadurch auf sie zukommen wird. Weiters werden Stimmen laut, die eine Schmälerung der Kreativität in der Küche durch die Kennzeichnungspflicht befürchten. Und Kellner äußern Ängste, sich medizinisches Fachwissen aneignen zu müssen.
Ob alles dann tatsächlich so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde, wird sich erst herausstellen. Trotz geplanter Kontrollen werden zumindest Strafen in nächster Zeit zumindest noch nicht verhängt.
Erstellt am 12. Dezember 2014
s, 12.12.2014