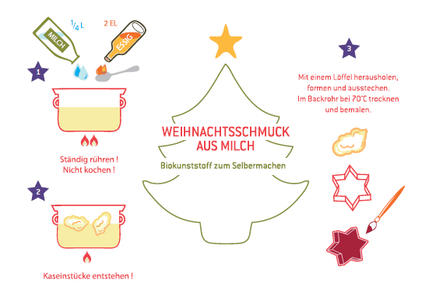Newsletter
Interview mit dem (Bio-)Kunststofftechniker Hannes Frech
Open Science:Was machen Sie hier am Institut für Kunststofftechnik in Tulln mit Bioplastik?
Hannes Frech: Meistens arbeiten wir projektbezogen, das heißt, ein Kunststoff-verarbeitender Betrieb kommt zu uns und hat ein ganz bestimmtes Produkt vor Augen, das er mit Biokunststoff umsetzen will. Warum, sei dahingestellt, meist steckt wahrscheinlich weniger ein technischer Grund dahinter, als dass er sich ein "grünes Mascherl" umzuhängen will. Die Kunden haben sich oft schon umgesehen, was es so an Biokunststoffen gibt, da gibt es sehr viele Informationen und Anbieter, aber man kommt zum Beispiel schwer an ein Materialmuster. Deshalb wenden sich viele an uns, weil sie nicht wissen, welchen Biokunststoff sie verwenden sollen, oder die Eigenschaften des Materials, das sie bisher testen konnten, für den Zweck nicht ausreichen sind. Das heißt, es ist zu spröde, zu weich, nicht transparent, oder Ähnliches.
Dann suchen wir dem Kunden das richtige Material heraus. Wir haben hier in den vergangenen Jahren ein sehr großes Spektrum an verschiedenen Biokunststoffen getestet und es gibt auch sehr viele Musterteile sowie Granulate für die Bemusterung im Haus. Man kann auch unterschiedliche Biokunststoffe mischen. Es gibt zum Beispiel einen berühmten Biokunststoff namens "Ecoflex", das ist eine sehr weiche, flexible Variante. Für manche Sachen ist das sehr gut, für andere unbrauchbar. Dann gibt es das typische PLA, Polylactid, das ist hingegen sehr steif und kann mitunter zerbrechen, wenn es auf den Boden fällt. Im einfachsten Fall mischt man die beiden Materialien zu gleichen Teilen und bekommt so einen Kunststoff mit einem ganz anderen Eigenschaftsprofil. Wir haben hier auch ein eigenes Prüfzentrum, wo man mechanische Tests mit den selbst hergestellten Mustergegenständen machen kann. Das heißt, wir können mit etwas Aufwand ein Material ganz spezifisch für eine bestimmte Anwendung anpassen.
Parallel dazu recherchieren wir immer, was es Neues von den verschiedenen Herstellern gibt. Wir versuchen dann immer ein Muster von den neuen Materialien zu bekommen und testen, wie gut sie verarbeitbar sind. Denn es gibt auch sehr schlechte Materialien am Markt, die man eigentlich einem typischen Kunststofftechniker gar nicht zumuten kann.
Sie haben angedeutet, manche Betriebe verwenden Biokunststoffe eher aus Imagegründen, wo macht es technisch Sinn solche Materialien zu verwenden.
Obwohl wir eigentlich ein Naturstoffinstitut sind, stehen wir Biokunststoffen gegenüber sehr skeptisch gegenüber. Schon die Definitionen rund um solche Materialien sind kompliziert und damit problematisch. Biokunststoff muss etwa nicht unbedingt biologisch abbaubar sein und es werden auch Materialien Bioplastik genannt, die nicht einmal aus nachwachsenden Rohstoffen sind. Verwirrend finde ich auch den Ausdruck 'kompostierbar', der sich vor allem auf technische Kompostieranlagen bezieht und nicht bedeutet, dass sich die Bioplastiksackerln im Komposthauen in absehbarer Zeit auflösen.
Polyethylen ist zum Beispiel ein sehr guter Biokunststoff aus Zuckerrohr, der zu 99 Prozenten aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, aber nicht biologisch abbaubar ist. Das heißt, wenn man glaubt, wenn man alles aus Biokunststoff macht, häuft sich weniger Plastik im Meer an, funktioniert das nicht so einfach. Es gibt natürlich PLA, das aus Maisstärke hergestellt wird, komplett aus nachwachsenden Rohstoffen stammt und kompostierbar ist. Dafür gibt es eine Norm, die besagt, dass die Teile in 99 Tagen zu 98 Prozenten unter Industriekompostierbedingungen verschwunden sein müssen. Und das funktioniert dort auch wirklich.
In Österreich wäre es vielleicht sinnvoller, herkömmliche Kunststoffe zu verwenden, die man ohnehin sammeln und wiederverwerten kann. Es gibt bei uns überall Sammelbehälter für Erdöl-Kunststoff, aber nicht für Biokunststoffe, weil die Menge, die davon anfällt, viel zu gering ist. Derzeit landen Biokunststoff-Joghurtbecher und was es sonst noch alles gibt, meist im Restmüll und werden dort verbrannt, oder die Leute werfen sie fälschlicherweise in den gelben Sack.
Man muss auch dazusagen, dass Biokunststoffe weit teurer als herkömmlicher Kunststoff sind, sie kosten oft zwei bis drei Mal so viel. Darum werden sie kaum von den Konsumenten angenommen, jedenfalls nicht in der großen Masse. Aber als Nischenprodukt machen sie sicher Sinn, etwa im Spielzeugsektor. Derzeit weiß niemand, was in den Kunststoffen für Spielzeug alles drinnen ist. Vor wenigen Jahren wurde Bisphenol A verboten, und bald ist auch ABS (Anmerkung: Acrylnitril-Butadien-Styrol) dran. Da müssen sich einige große Firmen, die dieses Material verwenden, Gedanken machen, was sie stattdessen verwenden. Ich gehe jezt einmal davon aus, dass in klassischen Biokunststoffen keine giftigen Weichmacher und Zusatzstoffe sind, die einen Menschen gefährden könnten.
Und wenn Erdöl noch teurer wird?
Dazu muss es schon wirklich massiv teurer werden. Es ist ja so, dass von all dem Erdöl, das gefördert wird, nur sieben Prozente für die gesamte chemische Industrie verwendet werden, der Rest wird als Treibstoff oder um Wärme zu gewinnen verbrannt. Man könnte viel mehr einsparen, wenn man die Häuser entsprechend dämmt und weniger mit dem Auto fährt, als wenn man alle Kunststoffe aus Pflanzen macht.
Macht es Sinn, Plastiksackerln zu verbieten?
Ich halte es für totalen Schwachsinn, wenn man sagt, es müssen jetzt alle Sackerln aus Biokunststoff gemacht werden, weil die Plastiksackerln ja im Meer enden und von Tieren gefressen werden, die dann daran zugrunde gehen. Das suggeriert ja: Schmeißt Biokunststoffsackerl einfach aus dem Autofenster, und in zwei Tagen sind sie weg. Das stimmt natürlich nicht, denn es braucht in der Natur auch Jahre, bis Biokunststoff verrottet ist. Ich finde, normale Plastiksackerln haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, wenn man sie öfters verwendet und am Schluss in den Recyclingprozess bringt, um neue Sachen daraus zu machen.
Wir viel vom Plastik kann man technisch recyceln?
Alles. 100 Prozent.
Wenn es sauber genug ist ...
Die Kunststoffe werden natürlich gereinigt, das Material im gelben Sack, wo die Verpackungsabfälle landen sollten, wird geschreddert, und die Kunststoffe werden aufgetrennt. Es gibt heute schon die technischen Möglichkeiten, die einzelnen Kunststoffe anhand ihrer Eigenschaften zu trennen. Österreich hat ganz tolle Firmen, die das machen und auch in der Herstellung von Recyclingmaschinen sind wir international top.
Das heißt, es hapert an der Konsequenz der Leute und der Politik, wenn nicht alles Plastik wiederverwertet wird?
Genau, aber das ist wohl nicht nur in diesem Bereich so.
Konkurrieren Biokunststoffe mit Lebensmitteln?
Dazu möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Wir hatten vor zwei Jahren ein großes Projekt mit einem deutschen Kleiderbügelhersteller, der Bügel aus reinem PLA haben wollte. Er hat sehr viel Geld in neue Werkzeuge und unsere Entwicklung investiert, und herausgekommen ist ein hochwertiger Kleiderbügel, der für den Konsumenten nicht von einem herkömmlichen Plastikteil unterscheidbar ist. Doch diesen Kleiderbügel wollte niemand kaufen. Einerseits ist der Preis natürlich um einiges höher, aber wir haben uns gefragt, ob es nicht Firmen gibt, denen dies egal ist, wenn sie ein Bioprodukt dafür bekommen, und die großen, weltweit agierenden Sportartikel-Hersteller angesprochen. Die wollten aber mit dem Ganzen nichts zu tun haben, weil Biokunststoffe als Konkurrenz zu Lebensmitteln wahrgenommen werden könnten. Sie wollten als internationale Konzerne nicht die Kritik riskieren, dass sie Menschen das Essen wegnehmen. Wenn man bedenkt, dass in Europa die Hälfte der Lebensmittel weggeworfen wird, kann man dies zwar schwer nachvollziehen, aber das ändert nichts daran, dass die Hersteller die Biokunststoffbügel meiden. Ich finde das unglaublich. Es werden zum Beispiel 60 Prozente der produzierten Stärke für Karton verwendet, weil ohne Stärkekleister würde das Papier einfach auseinanderfallen. Dies weiß keiner, und niemand regt sich auf. Aber wenn man Biokunststoff aus derselben Stärke macht, kommt die große Diskussion. Es ist teilweise sehr kurios, welche Argumente für oder gegen Biokunststoffe gebracht werden. Ich finde das Thema trotzdem interessant, und wir entwickeln gerne Rezepturen, damit man vernünftige Gegenstände daraus herstellen kann.
Der Kunststofftechniker Hannes Frech arbeitet am Institut für Naturstofftechnik des Interuniversitären Departments für Agrarbiotechnologie, IFA-Tulln (Universität für Bodenkultur Wien)
Laut eigenen Angaben liegt der Forschungsschwerpunkt des Instituts "in der Nutzbarmachung nachwachsender Rohstoffe sowie industrieller Nebenprodukte für den Spritzguss und die Profilextrusion". Es bietet außerdem für Kunden unter anderem an, Rohstoffe zu charakterisien, aufzubereiten und zu verarbeiten sowie fertige Werkstoffe zu prüfen.
s, 20.12.2013